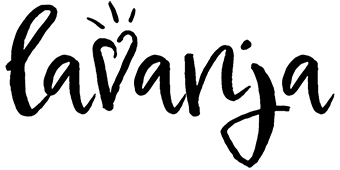Wie soll eine Mannschaft gewinnen, wenn der Trainer nicht an sie glaubt?
Unser schmerzlicher Weg zu den medizinischen Koryphäen
"Man macht aus einer Ente auch keinen Porsche mehr."
Hatte er das wirklich gerade über unser Baby gesagt, das hier neben uns im Gitterbettchen auf der Kinderintensivstation lag? Wir starrten sprachlos auf den Bildschirm des Laptops, von wo aus der Kinderneurochirurg per Videokonferenz so viel in uns zerstörte, wie man eben aus 450 km Entfernung maximal zerstören kann. Es sollte die letzte Zweit- (oder besser Fünft-)Meinung sein, die wir in diesem Zusammenhang einholten.
Fünf Monate zuvor war unser Baby zu früh geboren worden, und damit war eine Abwärtsspirale an Katastrophen und Diagnosen losgegangen: Hirnblutung, Hydrocephalus (weil durch die Hirnblutung die Hirnflüssigkeit nicht mehr ausreichend resorbiert wurde), Darmverschluss, dann NEC, was bedeutet, dass immer mehr Darm abstirbt, schließlich das Kurzdarmsyndrom, bei dem so wenig Dünndarm übrigbleibt, dass es zunächst oder für immer unmöglich ist, sich allein über den Magen-Darm-Trakt zu ernähren. Es musste nun ein Weg gefunden werden, wie die Hirnflüssigkeit innerhalb des Körpers abgeleitet werden konnte. Die gängigste Option dafür war der Bauchraum, aber da der Bauch nun schon so oft operiert worden war und mit dem Darm auch ganz viel Resorptionsfläche fehlte, war dies wenig vielversprechend. In der Uniklinik, in der unser Baby seit der Geburt lag, tat man also: Nichts. Was nicht ganz stimmte: Den Kontakt zu eben jenem Kinderneurochirurgen, der uns nun virtuell gegenübersaß, hatte der Chefarzt der Kinderintensivstation hergestellt, nachdem wir Eltern eine wissenschaftliche Veröffentlichung gefunden hatten. Die Videokonferenz aber fand um 20 Uhr statt und da hatte er schon Feierabend gemacht. Mein Mann und ich saßen also alleine vor dem Bildschirm und fanden unsere Sprache nur schwer wieder. Wir hatten die Hoffnung gehabt, dieser Arzt wäre mit seiner Methode, die Liquorräume zu fenstern, die Antwort auf all die Ratlosigkeit, die uns seit Wochen und Monaten entgegensprang. Er aber ließ nicht davon ab, auch den Plexus im Gehirn veröden zu wollen, ungeachtet dessen, was das für Folgen auf die Entwicklung unseres Babys haben könnte. Bis hierher hatte sich unser Sohn normal entwickelt. Trotz der Hirnblutung. Und die entsprechende schriftliche Beurteilung der Kinderphysiotherapeutin zeigte, dass diese Einschätzung nicht nur unserem liebevollen, vielleicht verklärten elterlichen Blick entsprach. Wir wollten keine weitere Verletzung des Gehirns mit fragwürdigen Erfolgsaussichten zulassen. Und jetzt das: "Man macht aus einer Ente auch keinen Porsche mehr." Und: „Was muss er jetzt schon können? Er ist ein Baby. Er muss nur süß sein. Wenn er aber mal zwei ist, wird er gar nichts können.“ Auch mein Mann benutzte, als wir uns verabschiedet und den Laptop zugeklappt hatten, eine Metapher: "Wie soll eine Mannschaft gewinnen, wenn der Trainer nicht an sie glaubt?" Die Idee, unseren Sohn dorthin verlegen zu lassen, hatten wir nun begraben. Und mit ihr die Hoffnung, dass es einen Experten oder eine Expertin gäbe, der oder die nicht nur glaubte, zu wissen, was zu tun ist, sondern uns auch glaubhaft versichern konnte, dass wir endlich diese Last der Verantwortung abgeben konnten. Denn dies war neben den etlichen Gesprächen, die wir mit den Ärztinnen und Ärzten in unserer Heimat-Uniklinik geführt hatten, bereits die vierte von uns extern eingeholte Meinung.
Die fünf Teams schlugen unterschiedliche Verfahren vor und verteufelten jeweils alle anderen vier Vorschläge:
In unserer Klinik wollten die Kinderärzt:innen, dass die Neurochirurgen den Shunt in den Bauch legten (wobei es zu diesem Versuch dennoch immer noch nicht gekommen war, wahrscheinlich gab es intern Unstimmigkeiten). Die Kinderneurochirurgin einer Klinik etwa eine Stunde von uns entfernt bat uns inständig, unseren Sohn nicht zu ihnen verlegen zu lassen, denn sie würden in diesem Fall gar nichts tun und das Kind im Krankenhaus behalten, bis es keine Infusion mehr bräuchte, auch wenn das ein Jahr oder mehr wäre. Die Kinderneurochirurgen einer weiteren Klinik wollten den Liquor in die Vene ableiten, aber alle anderen schlugen die Hände über dem Kopf zusammen und vertraten vehement die Auffassung, dass unser Sohn dann ein viel zu großes Risiko für eine Thrombose oder eine Infektion im Gehirn hätte dadurch, dass auch der zentrale Venenkatheter vorhanden war. Wieder ein anderer Kinderneurochirurg, dessen Chef wohl zuvor in unserer Heimat-Klinik gearbeitet hatte und uns von der leitenden Hebamme empfohlen worden war, schlug einen Pleurashunt vor, in dem der Liquor in den Zwischenraum zwischen Lunge und Thorax abgeleitet wurde. Aber auch er stand mit diesem Vorschlag komplett alleine da. Und nun das Nicht-Abrücken-Wollen von der Verödung des Plexus' im Gehirn, was in unserer Klinik mit Erschrecken wahrgenommen und als aussichtslos eingeschätzt wurde. Wir trügen keine Verantwortung, die Ärzte würden entscheiden, was zu tun ist, meinte der Klinikdirektor entrüstet zu uns. Doch dies war grundlegend falsch: Bei fünf Kliniken mit fünf konträren Vorschlägen entschieden wir Eltern trotz fehlenden medizinischen Fachwissens sehr wohl, welche Methode angewendet würde, nämlich schlicht und ergreifend dadurch, dass wir entschieden, ob und wohin wir unseren Sohn verlegen lassen würden.
Wie ein Reh im Scheinwerferlicht blieben wir mit unserem Baby, wo wir waren.
Man versuchte dann in mehreren OPs, die Ventrikel zu fenstern - ohne Verödung im Gehirn - und als dies erfolglos blieb, wurde ein Shunt in den Bauchraum gelegt. Niemand hatte damit gerechnet, aber es funktionierte. Dass wir nach fast neun Monaten endlich mit unserem Baby nach Hause entlassen wurden, hätte ein Ende der Geschichte sein können, welches zeigt, dass man sich als Eltern nicht verunsichern lassen sollte durch das Einholen von Zweitmeinungen. Hätte.
Doch die Geschichte nahm eine dramatische Wendung, als eben dieser Shunt zehn Monate später nicht mehr funktionierte.
Unser Sohn geriet in Lebensgefahr: Wachsender Hirndruck und eine Liquorzyste im Bauch, die erst den Darm und dann auch den Harnleiter abklemmte. In unserer Heimat-Uniklinik wurde das Ende des Shunts in das kleine Becken verlegt, doch der Bauchraum konnte den Liquor auch dort nicht mehr ausreichend resorbieren. Wir gingen die einstigen Optionen durch: Abwarten nicht möglich, Plexus-Verödung keine Option für uns, der Shunt in die Vene immer noch ein zu hohes Risiko aufgrund des zentralen Venenkatheters, über den unser Sohn nach wie vor ernährt wurde, der Shunt in den Bauchraum gescheitert - es blieb nur noch der Pleurashunt. Während der Kinderneurochirurg das gerne testen wollte, waren der Stationsoberarzt - gleichzeitig unser Kindergastroenterologe - und der Neuropädiater davon überzeugt, dass ein solcher Shunt Schmerzen bei jedem Atemzug machen würde. Und so entschied man sich, unseren vergnügten (!) Sohn, der gerade den Vierfüßlerstand gelernt hatte und die ersten einzelnen Wörter sprach, nicht mehr länger "um Ihretwillen leiden" zu lassen, sondern einen Palliativpflegedienst einzuschalten, der uns auf diesem letzten Weg begleiten würde.
Wir packten hastig unsere sieben Sachen und unseren Sohn, und kaum waren wir im Auto, riefen wir den Kinderneurochirurgen an, der damals den Pleurashunt ins Spiel gebracht hatte. Wie immer ging er persönlich ans Telefon. "Die lassen unseren Sohn sterben!", flehten wir ihn verzweifelt an. Wenigstens EINE weitere Meinung brauchten wir, die bestätigte, dass ein Weiterkämpfen egoistisch und unserem Sohn nicht mehr zuzumuten wäre, um diesen Weg tatsächlich gehen zu können. Der Professor hörte aufmerksam zu und versicherte dann, er würde uns schnellstmöglich zurückrufen. Tatsächlich bestätigte er uns ein paar Minuten später: In ein paar Tagen habe er ein Bett frei und unser Sohn könne stationär aufgenommen werden. Wir könnten die 350 km weite Reise schon vorher antreten, um in der Nähe zu sein, falls die Symptome stärker würden. Der Weg über die Notaufnahme wäre auch vor der geplanten Aufnahme jederzeit möglich.
Als wir packten, wussten wir nicht, ob wir nach dieser Reise zu dritt oder zu zweit heimkehren würden.
Rückblickend kann ich gar nicht fassen, dass man uns so gar nicht ansieht, in welcher Situation wir da sind. Wir sitzen 350 km von Zuhause entfernt im Café, wenige Tage, nachdem in unserer Heimat-Uniklinik entschieden worden war, dass man unser Kind nun sterben lässt, und warten darauf, dass unser Sohn stationär aufgenommen wird und ihm hoffentlich das Leben gerettet werden kann.
Man mag sich vorstellen, mit welch beklemmendem Gefühl wir dem Kinderneurochirurgen der Universitätsmedizin weit von Zuhause entfernt in dieser Situation gegenübertraten. Hier würde sich entscheiden, ob unser Sohn weiterleben würde oder ob wir der Wahrheit ins Auge blicken mussten. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass diese Wahrheit keine war: Der Pleurashunt sei zwar experimentell, auch er habe ihn erst drei Mal gelegt, aber keins dieser drei Kinder habe Schmerzen, schon gar nicht bei jedem Atemzug, versicherte uns der Kinderneurochirurg hier. Man müsse nur bedenken, den Shunt oberhalb der Rippen entlang zu führen, da die Nerven unterhalb liefen. Schon wenige Tage nach der OP sprach man über eine baldige Entlassung. Wir konnten nicht fassen, dass es geschafft war. Und gleichzeitig wollten wir auf keinen Fall zu dem Kindergastroenterologen in die Heimat-Uniklinik zurück, der bisher alle zwei Wochen die Infusion unseres Sohnes anhand aktueller Blutwerte neu berechnete. Wir fragten, ob wir nicht hier in der Universitätsmedizin auch bezüglich des Kurzdarmsyndroms angebunden werden konnten. Hierauf kam die Antwort, die das Leben unseres Sohnes und unsere Leben massiv verändern sollte:
"Wir haben einen Kindergastroenterologen hier im Haus und wir halten sehr große Stücke auf ihn. Aber mit dem Kurzdarmsyndrom muss man zu Spezialisten. Wenn Sie einverstanden sind, würden wir gerne den Kontakt zu Frau Dr. Nektar herstellen." (So heißt die Kurzdarmspezialistin nicht. Ich nenne sie hier nur so für alle, die das Buch "Flieg, Hummelchen, flieg" von Judith Beier und Nora Imlau kennen. Es handelt sich tatsächlich um genau diese Ärztin, von der wir bis dato nichts wussten.)
Etwa eine Woche später kamen wir also in einer dritten Universitätsklinik an,
nun 550 km von Zuhause entfernt, mit unserem Sohn, dem gerade das Leben gerettet worden war, aber der aufgrund einer ganz anderen Baustelle auf künstliche Ernährung über die Vene angewiesen war. Und auch hier standen wir mit einem beklemmenden Gefühl. Die Oberärztin der Kinderintensivstation in unserer Heimat-Uniklinik hatte prognostiziert, er würde früher oder später an dieser Infusion, die er nicht loswerden würde aufgrund des zu wenig verbleibenden Dünndarms, sterben, da es irgendwann entweder zu einer lebensbedrohlichen Kathetersepsis oder zu einem zu großen Leberschaden käme. Und das, noch bevor er erwachsen wäre. "Wir werden uns also noch einmal wiedersehen und über das Abschalten der Geräte sprechen", hatte sie uns, als unser Sohn etwa sechs Monate alt gewesen war, beim Umzug von der Kinderintensivstation auf die Frühchenstation mit auf den Weg gegeben. Ich musste also all meinen Mut zusammennehmen, um mich für die Antwort auf meine Frage zu wappnen, die mir so sehr auf der Seele brannte: "Wird er die Infusion jemals loswerden?" "Ja klar, geben Sie mir ein Jahr. Er hat doch Muttermilch bekommen." Wir waren baff. Das stimmte, er hatte irgendwann endlich Muttermilch bekommen. Monatelang hatte ich auf der Kinderintensivstation Milch abgepumpt, obwohl uns gesagt worden war: Muttermilch, bei dem Kurzdarmsyndrom, das sei „ja eine abstruse Idee“. Was hatten wir dafür gekämpft, diesen Versuch wagen zu dürfen, bevor unser Baby mit fünf Monaten endlich eine der Mahlzeiten ersetzt bekommen durfte. Wir hatten gewusst, dass das gut gehen würde, denn wir hatten eine erfahrene Pflegerin an der Seite gehabt, die schon vorher immer mal wieder, versteckt vor dem ärztlichen Personal, erst 1 ml Muttermilch direkt nach dem Abpumpen abgezweigt und ihm in den Mund gegeben und irgendwann sogar das Patientenzimmer umgeräumt hatte, damit wir, wenn die Luft einigermaßen rein war, heimlich erste Stillversuche wagen konnten. Was wir nicht wussten: Dass Muttermilch beim Kurzdarmsyndrom offenbar überhaupt nicht abstrus und im besten Fall nicht nur nicht schädlich, sondern sogar total gewinnbringend wäre. Wie auch? Das medizinische Personal in unserer Heimat-Klinik fühlte sich zu kompetent, um sich an Spezialistinnen oder Spezialisten zu wenden, und uns Eltern fehlte an dieser Stelle das Fachwissen.
Die Kurzdarmspezialistin warf nun fast alles über den Haufen, was bisher in der Heimat-Uniklinik angeordnet worden war: Wir gaben bis dato offenbar unserem Sohn acht Mal täglich Medikamente im Abstand von immer zwei Stunden zum Schutz von Galle und Leber - allerdings in homöopathischen Dosen. Da die Organe trotzdem keinen Schaden genommen hatten, konnten wir die Medikamente also komplett absetzen. Es wurde eine Infusionspause eingeführt, denn die ununterbrochene Infusion 24 Stunden täglich war leberschädigend. Alle zwei Wochen die Infusion neu zu berechnen, war wohl ziemlich überambitioniert gewesen. So schnell würden sich die Auswirkungen im Blut gar nicht zeigen. Von nun an sollte es reichen, alle paar Monate Blut abnehmen zu lassen und der Spezialistin die Ergebnisse zu schicken. Und schließlich musste eine PEG (Magensonde durch die Bauchdecke) gelegt werden, um den Darm mittels kontinuierlicher Sondierung ausreichend aufzubauen.
Insgesamt 35 Tage, nachdem in der Heimat-Uniklinik die Welt für uns zusammengebrochen war, kamen wir zu dritt und quietschfidel zurück nach Hause.
Und nun kommt das tatsächliche Ende der Geschichte: In der Tat benötigte unser Sohn ein Jahr später keine Infusion mehr. Der zentrale Venenkatheter wurde explantiert und unser Kind ist seitdem nicht mehr lebensverkürzend erkrankt. Der Pleurashunt ist keine dauerhafte Lösung gewesen, aber hat unserem Sohn das Leben gerettet. Vor 4,5 Jahren haben die Kinderneurochirurgen den Shunt in den Bauch gelegt, und dieser Shunt funktioniert seitdem einwandfrei. Wir sind nach wie vor in den beiden Universitätskliniken angebunden, bei den Kinderneurochirurgen 350 km von Zuhause entfernt und bei der Kurzdarmspezialistin 550 km entfernt. In die Uniklinik in unserer Heimatstadt gehen wir nur im Notfall. Und vielleicht müssen wir den beiden Ärzten hier in der Heimat-Uniklinik fast dankbar sein, dass sie damals in der lebensbedrohlichen Situation verweigert haben, noch irgendwas zu tun. Nie wären wir sonst zu den Koryphäen der Kinderneurochirurgie und des Kurzdarmsyndroms gekommen. Und dann wäre unser Sohn tatsächlich nie die Infusion losgeworden.
2025
Autorin und alle Bilder: Alexandra Yatim